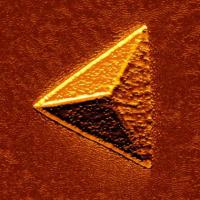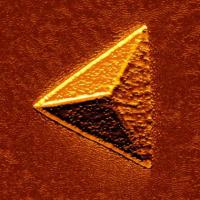|
Nanoscience and -technology ist derzeit noch
relativ stark von der Grundlagenforschung geprägt. Dafür,
aber auch für die zügige Umsetzung der Erkenntnisse in
entsprechende Technologien und Prototypen und nicht zuletzt für
die interdisziplinäre Ausbildung künftiger Wissenschaftler
und Ingenieure auf diesem Zukunftsgebiet ist eine umfangreiche
Infrastruktur in den Bereichen Materialherstellung, Nanostrukturierung
und insbesondere Analytik notwendig. Durch das langjährig
gewachsene Nano-Netzwerk in Linz wurden im letzten Jahrzehnt auch nach
und nach wesentliche Infrastrukturmaßnahmen getätigt, die
für ein international erfolgreiches Agieren auf diesem Gebiet
notwendige Voraussetzung sind. Im folgenden soll kurz der derzeitige
Stand der Infrastruktur bezüglich Nanoscience and -technology an
der TNF dargestellt werden.
Technische Service Einrichtung (TSE) der TNF-Fakultät
Die Technische Service-Einrichtung (TSE) der TNF ist seit Ende der neunziger Jahre
als zentrale Einrichtung direkt dem Senat der Johannes Kepler
Universität unterstellt. Ihr Zweck ist die Beschaffung, der Unterhalt
und z.T. der Betrieb mit eigenem Personal von gemeinsam genutzten
Großgeräten und Service-Einrichtungen.
Ein großer Teil des in der TSE vorhandenen Gerätepools ist
für die Analytik von Nanostrukturen nutzbar. Beispiele umfassen
Elektronen- und Kernspinresonanz-Apparaturen,
Raster-Elektronenmikroskope, den einzigen universitären
Ionenimplanter in Österreich, Röntgendiffraktometer
usw. Daneben ist auch die Anlage für die He-Verflüssigung
und -Rückgewinnung in der TSE angesiedelt, die als zentrale
Einrichtung von viele Instituten der Physik und Chemie genutzt
wird. Ende der neunziger Jahre wurde im Rahmen des
Investitionsprojektes Mikro- und Nanotechnologie der TNF ein
Transmissions-Elektronenmikroskop (TEM) beschafft und mit
zusätzlichen Mitteln des Landes und aus den Universitäts-
und Forschungssondermitteln des Jahres 2001 (sogenannte
Universitäts- bzw. Forschungsmilliarde) ausgebaut und in die TSE
eingeglieder. Mit dem bereits vorhandenen Rasterelektronenmikroskop
mit Mikrosonde steht damit an der TSE eine vollständig
eingerichtetes Elektronenmikroskopielabor zur
Verfügung. Entsprechend vielfältig ist auch der Kundenkreis,
der nicht nur die TNF-Institute sondern auch Kooperation mit
österreichischen Firmen umfaßt. Reinräume
Anfang der neunziger Jahre wurde das Institut für Halbleiterphysik
in Linz geschaffen und als wesentliche Infrastrukturmaßnahme mit einem
ca. 200 mē großen Reinraum ausgestattet. Neben dem später
dazugekommenen Reinraum der Festkörperelektronik an der TU Wien
ist dies der einzige voll ausgestattete Reinraum an einer
österreichischen Universität. Der Reinraum des Instituts
für Halbleiterphysik enthält alle Einrichtungen zur
Abscheidung von Halbleiterheterostrukturen
(Molekularstrahlepitaxieanlagen für Gruppe-IV-, IV-VI- und
II-V-Halbleiterheterostrukturen), zur Strukturierung im
Nanometer-Maßstab (optische und Elektronenstrahllithographie,
Reaktives Ionenätzen) und zur Herstellung von
Prototyp-Bauelementen (Metallisierung, Abscheidung von Dielektrika,
Rapid-Thermal-Annealing, Bonder). Darüber hinaus sind
On-Wafer-Meßeinrichtungen (Parameter-Analyzer, L-R-C-Brücke)
vorhanden, mit denen die Bauelemente nach jedem Prozeßschritt
elektrisch charakterisiert werden können.
Neben dem Reinraum der Halbleiterphysik gibt es auch noch einen
kleineren Reinraum am Institut für Mikroelektronik des
Fachbereichs Mechatronik, der ebenfalls über Abscheide- und
Strukturierungseinrichtungen für die Herstellung von
Hochfrequenzbauelementen auf der Basis von III-V-Halbleitern
verfügt. Den Reinräumen an der Johannes Kepler
Universität kommt österreichweit eine Schlüsselstellung
in Forschung und Lehre zu. Laserlabor
Laserbearbeitungsverfahren haben sich in den
letzten 30 Jahren in vielen Bereichen der Industrie und Medizin einen
festen Platz erobert. Durch Reduzierung der verwendeten
Wellenlängen und durch den Einsatz laserinduzierter chemischer
und chemo-thermischer Effekte lassen sich so heute auch Strukturen mit
lateralen Dimensionen von ca. 100 nm herstellen. Daneben lassen sich
durch Laserablation dünne Schichten mit speziellen Eigenschaften
abscheiden, in die dann z.B. Nanopartikel eingebettet werden
können. Die Voraussetzung für derartige
Forschungsaktivitäten wurde in Linz durch die Einrichtung eines
Laserlabors mit kurwelligen, gepulsten Exzimerlasern in den neunziger
Jahren geschaffen.
Investitionsprojekt Mikro- und Nanotechnologie der TNF
Ende der neunziger Jahre wurde in der
TNF-Fakultät das Investitionsprojekt Mikro- und Nanotechnologie
nach UOG 93 geschaffen. Von einem Konsortium aus mehreren Instituten
aus den Fachbereichen Physik, Chemie und Mechatronik wurde ein
Dreijahresprogramm entwickelt, das neben der Stärkung der
Infrastruktur auch einen Post-Doc-Pool zur verstärkten
Aktivierung interdisziplinärer Forschung auf dem Gebiet der
Mikro- und Nanotechnologien vorsah.
Das Projekt wurde zwischenzeitlich zumindest teilweise hinsichtlich
seines Investitionsanteils umgesetzt. Mit Mitteln des
Forschungsministeriums, des Landes Oberösterreich und aus Mitteln
der Forschungs- und Universitätsmilliarden wurde das in der TSE
angesiedelte Transmissions-Elektronenmikroskopielabor (siehe oben
unter TSE) und die zugehörigen Präparationseinrichtungen
realisiert. Daneben wurden weitere Geräte der Nanoanalytik
beschafft, die jeweils Kooperationsvorhaben von wenigsten zwei
Instituten zugute kommen. Insgesamt wurden im Rahmen dieses Projektes
mehr als 1.2 Mio. direkt in den Ausbau der Nanoscience and
-technology-Infrastruktur investiert.
Nanoanalytik
Bei der Einwerbung von Mitteln aus der vom Bund
2001 ausgeschriebenen, sogenannten Universitätsmilliarde war die
TNF-Fakultät österreichweit besonders erfolgreich. Ein
beträchtlicher Teil der nach Linz vergebenen Mittel kam dabei der
Nanoanalytik zugute. So wurden Mittel in Höhe von etwa 1.5 Mio.
für die Laborerneuerung und den Ausbau der Nanotechnologie im
Bereich der Halbleiter- und
Festkörperphysik investiert, ca. 0.4 Mio. flossen in das
o.a. Investitionsprojekt Mikro- und Nanotechnologie, und ein
ähnlicher Betrag wurde in der Oberflächenphysik
für das erste PEEM-System (Photoemissions-Elektronenmikroskopie)
in Österreich und eine Niederenergie-Ionenstreuapparatur (LEIS)
investiert. Mit diesen Mitteln wurde gezielt die Nanoanalytik
ausgebaut, die bereits zuvor eine in Österreich herausragende
Stellung besaß. So befinden sich zahlreiche Analytikeinrichtungen
über die hier aufgeführten, gemeinsam nutzbaren Geräte
hinaus an den einzelnen Instituten und Abteilungen. Dazu gehören
sicher die Rastersondenmikroskope, die inzwischen mehrfach in
z.T. spezialisierten Ausführungen in den Bereichen Angewandte
Physik, Atom- und Oberflächenphysik, Biophysik, und
Halbleiterphysik vorhanden sind. Andere Analytikmethoden betreffen die
optischen Eigenschaften von Nanosystemen, die mit verschiedenen
hochauflösenden Spektrometern an mehreren Instituten untersucht
werden oder die elektronischen Eigenschaften, die z.B. durch
Transportuntersuchungen bei tiefen Temperaturen und bei hohen
Magnetfeldern vermessen werden können. CD-Laboratorien
Im Bereich Nanoscience and -technology wurden in
den vergangenen Jahren zwei Laboratorien der
Christian-Doppler-Gesellschaft eingerichtet ( CD-Labors),
die wegen ihrer obligatorischen Industriebeteiligung für
besondere Anwendungsnähe stehen.
- CD-Labor "Organische Solarzellen" in der Physikalischen
Chemie
Das CD-Labor
Organische Solarzellen wird vom Institut für Physikalische
Chemie (Prof. Sariciftci) und der Firma Konarka Austria betrieben. Es
befaßt sich mit der Verwendung von Polymerfilmen für die
Herstellung großflächiger, preisgünstiger
Plastik-Solarzellen. In das Projekt fließen vielfältige
Erkenntnisse der Nanowissenschaften ein. So werden die Solarzellen mit
Nanopartikeln als wesentliche Funktionsgruppen des schnellen
Ladungstransfers dotiert. Der Synthese derartiger Nanopartikel,
beispielsweise aus InCuSe2, kommt daher eine wesentliche Bedeutung
zu.
- CD-Labor "Oberflächenoptische Methoden" in der
Festkörperphysik
Das CD-Labor
Oberflächenoptische Methoden wird vom Institut für
Festkörperphysik (Doz. Hingerl) und der Firma Photeon aus
Vorarlberg betrieben. Es befaßt sich mit der Simulation und
Demonstration sogenannter Photonischer Kristalle. Das sind periodische
Modulationen der optischen Eigenschaften eines Festkörpers oder
Polymers, die zu neuartigen optischen Eigenschaften
führen. ähnlich wie in einem herkömmlichen Kristall
entstehen Energie- bzw. Wellenlängenbereiche, in denen sich das
Licht nicht ausbreiten kann. Aus Photonischen Kristallen lassen sich
so beispielsweise Lichtwellenleiter, energiedispersive Strahlteiler
und ähnliche Komponenten auf kleinstem Raum realisieren, wie sie
beispielsweise für integrierte Optik auf einem Halbleiterchip
oder für optische Multiplexer benötigt werden. Die dazu
nötigen Strukturgrößen liegen im Bereich einiger 100 nm,
wobei aber hohe Anforderungen an die Maßhaltigkeit der Strukturbreiten
und an die Positioniergenauigkeit gestellt werden. Für die
Herstellung der Prototypen werden daher die am Institut für
Halbleiter- und Festkörperphysik vorhandenen
Elektronenstrahllithographie und andere Reinraumeinrichtungen
eingesetzt. |